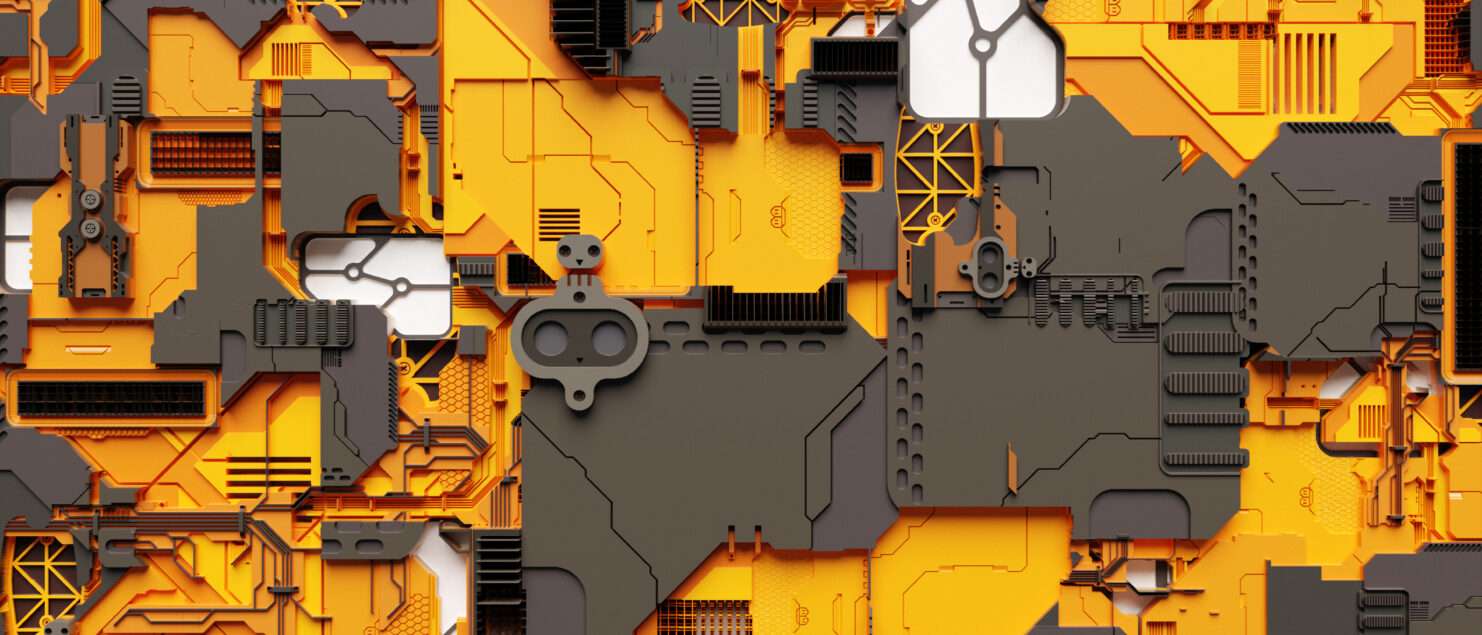»Es ist nur … ein bisschen schwieriger für mich«
Carlotta Herland lektoriert eine Maschinenübersetzung von Melissa Fergusons Meet Me in the Margins, ohne den Originaltext zu kennen. Ob das gutgehen kann, erläutert sie in ihrem Bericht.
Meine Aufgabenstellung lautete, eine maschinelle Übersetzung zu lektorieren, als wäre sie ein originär deutscher Text, und dabei den (mir nicht vorliegenden) Ausgangstext nicht zu beachten.
Hier steckt die erste Tücke schon in der Aufgabe. Wüsste ich nicht ohnehin, dass es sich eben nicht um einen originär deutschen Text handelt, sondern um eine durch künstliche Intelligenz erzeugte Übersetzung, hätte ich es spätestens nach der Lektüre des ersten Halbsatzes (»Ich schreite in der hinteren Ecke des überfüllten Besprechungsraums«) gewusst. Die Originalsprache schimmert so deutlich durch, dass ich sofort gewarnt bin: Dieser Text muss nicht nur so lektoriert werden, dass er angenehm lesbar ist, sondern auch auf etwaige Falschübersetzungen überprüft werden. Hinzu kommt, dass es für eine Übersetzerin quasi unmöglich ist, den Ausgangstext nicht zu beachten. In jedem übersetzten Buch, das ich lese, und in jedem synchronisierten oder untertitelten Film, den ich mir ansehe, schwingt der Ausgangstext mit, zumindest, wenn es sich um mein Sprachpaar handelt.
Normalerweise lese ich einen Text nicht komplett durch, bevor ich ihn lektoriere oder übersetze, da ich an jeder Stelle den (auf den Text bezogenen) Wissensstand der rezipierenden Person behalten möchte. Das ist im Fall dieser Übersetzung nicht möglich, da sie so viele Fehler und Stilblüten (»… warum keiner in den Reihen vor mir oder um mich herum auch nur mit den Augen flackert«) enthält, dass man sich nicht auf den Inhalt des Textes konzentrieren kann. Also beschließe ich, den Text vor der Bearbeitung durchzulesen und all das gelb zu markieren, was mir komisch vorkommt.
Obwohl ich die Anstreichungen nur auf der Wort- und Redewendungsebene vornehme und über den Satzbau, der häufig deutlich englisch ist (»Es ist nur … ein bisschen schwieriger für mich«) hinwegsehe, wird dabei ein Viertel des Textes gelb. Und die Markiererei dauert ewig – weil sie inspirierend ist. Ich will einen Text lektorieren und meine Überlegungen währenddessen stichwortartig festhalten, um sie in dieser Reflexion aufzugreifen. Aber durch dieses Auf-die-Goldwaage-Legen jedes einzelnen Wortes (Auch beim Übersetzen ist man immer mit der Goldwaage unterwegs, aber man legt eben nicht jedes Wort darauf!) und das Nachdenken über die jeweilige Entscheidung wird jede Stilblüte zur Muse, jeder Fehler zum Schreibanlass. Und noch bevor ich mit meinem digitalen Gelbstift das Ende der ersten Seite der Maschinenübersetzung erreicht habe, ist das Überarbeitungsprotokoll, das ich nebenher anfertige, fast zwei Seiten lang und der Schreibtisch voll mit Kaffeetassen, Riegelpapier, Tierbüchern … kurz: Ich bin im Flow. In meinen eigenen Text vertieft. In meine Metaüberarbeitung, oder, wenn man so will, Metaübersetzung, denn natürlich übersetze ich beim Anstreichen jedes Wort, jede Redewendung, jeden Satz zurück ins Englische und vergleiche das, was da schwarz auf weiß vor mir steht, mit dem mutmaßlichen Originalsatz, der in meinem Kopf erklingt. Das heißt: Ich kann diesen Text nicht überarbeiten, als wäre er originär deutsch, zu laut dröhnt die englische Sprache heraus. Aber gleichzeitig kann ich das Original, das ich durchhöre, nicht unvoreingenommen übersetzen, da mir in Form der von der künstlichen Intelligenz erzeugten Übersetzung ja schon Vorschläge unterbreitet wurden, die meine Entscheidungen beeinflussen.
An diesem Punkt ist schon klar, dass die Überarbeitung des Textes für mich aufwendiger und zeitintensiver sein wird als eine eigene Übersetzung des Originals. Denn statt mit zwei Texten (Ausgangstext und Zieltext) habe ich es hier mit drei Texten zu tun: mit dem zu lektorierenden Text, dem Zieltext und dem mutmaßlichen Ausgangstext. Weil mir der tatsächliche Ausgangstext nicht vorliegt, kann ich an Punkten, die mir verdächtig vorkommen, aber nicht nachschauen, ob die maschinelle Übersetzung sich vergaloppiert hat. Da sind zum Beispiel diese Fischadler. Die sind mir suspekt, weil ich ahne, dass eine maschinelle Übersetzung nicht nur aus dem Osprey (Pandion haliaetus), sondern auch aus einem unspezifischen fish eagle (Haliaeetus sp.), also einem Seeadler, einen Fischadler machen kann – und ein kurzer Check bestätigt meine Vermutung. Obwohl die korrekte Bezeichnung für den Greifvogel wohl eher irrelevant für einen Liebesroman ist, lässt mir die Sache keine Ruhe, also wende ich die Formulierungssuche an. Tatsächlich ist im fast komplett auf Google Books befindlichen Original von Ospreys die Rede, und ich klicke die Seite schnell wieder zu, da das Original ja eigentlich qua Workflow tabu für mich ist. Allerdings bin ich nicht schnell genug und sehe, dass der »widerwillig zuvorkommende Kollege« hier nicht in seiner Wesensart beschrieben wird, sondern als einer, der widerwillig Platz macht, also wahrscheinlich während der Konferenz die Beine einzieht oder ähnliches. Das kann ich nun, wo ich es weiß, nicht mehr ignorieren und korrigiere die entsprechende Stelle.
Anschließend schlage ich mich mit etwas rum, das einen auch bei einer Übersetzung viel Zeit kosten kann, wenn man nicht zur Larifarifraktion gehört: Wie nennt man einen Verband von Greifvögeln, die einzelgängerisch leben? Dass DeepL hier eine falsche Wahl getroffen hat, ist nicht weiter verwunderlich und bestätigt meinen Verdacht, dass mir der Onlinedienst an heiklen Stellen die Arbeit nicht erleichtern kann. Das Gleiche gilt für cheesy Glänzvergleiche, mit denen man es in Trivialliteratur so oft zu tun hat. Die Unterschiede zwischen strahlen, glänzen, funkeln und glitzern sind minimal, und welche Dinge was tun können, deckt sich beim Sprachpaar Englisch – Deutsch nicht. Die Augen »scheinen« im Deutschen nicht. Und selbst nach Einsetzen der richtigen photonenemittierenden Vokabel kann das Ganze im Deutschen cringy sein, vor allem, wenn das Bild schon im Englischen schief hing. Ob ich eine CEO Chefin nenne oder sie CEO sein lasse, ob ich eine Ms. Ms. sein lasse oder eine Frau aus ihr mache, ob ich die Vokabel epistemophiliacs in einem prätentiös klingenden Buchtitel mit Epistemophile oder lieber mit Wissbegierige oder Wissensdurstige übersetze, wodurch aber aus dem erwähnten Buch, das sich an Leser richtet, die sich für etwas Besseres halten, eine Art »Schotts Sammelsurium« oder eine andere Faktenschleuder wird – diese kleinen und großen Entscheidungen kann mir eine maschinelle Übersetzung nicht abnehmen, da sie nicht all das minutiös gegeneinander abwägen kann, was in die Wortwahl hineinspielt.
So arbeite ich alle gelb markierten Stellen ab und markiere all das, womit ich noch nicht zufrieden bin, rot. Es sind nur wenige rote Stellen, aber sie sind sehr rot. Anschließend überprüfe ich den grob überarbeiteten Text auf Anglizismen und Korrekturfehler. Von Letzteren sind viele drin, was Erstere betrifft, bin ich mir nicht so sicher: Sachen, die man gelesen hat, und die nicht komplett falsch klingen, vernebeln einem das Sprachgefühl. Beim »normalen« Übersetzen hat man schon das Problem, dass die Ausgangssprache mit der Zielsprache interferiert, vor allem dann, wenn die Sprachen sich so ähnlich sind wie das Englische und das Deutsche. Wenn man aber diese vermeintlich korrekten Sätze bereits schwarz auf weiß gelesen hat, fällt es umso schwerer, sie als falsch formuliert zu erkennen.
Die roten Stellen verschwinden bei diesem Durchgang nicht. Sie bleiben also als letzte zu knackende Nüsse für einen weiteren Durchgang übrig. Es sind drei grundverschiedene Kategorien von Problemfällen. Einmal sind es Stellen, bei denen ich ganz genau weiß, welchen Inhalt, welche Konnotation ich haben möchte, ich aber das passende deutsche Wort einfach nicht finde. Dabei weiß ich nicht, ob es das Wort nicht gibt, ob es mir nicht einfällt, oder ob ich schlicht zu genau bin. An eben diesen Stellen würde ich auch bei einer eigenen Übersetzung hängen bleiben. Das Gleiche gilt für Stellen, an denen ich mich nicht entscheiden kann, ob ich eine englische Bezeichnung stehenlasse – sei es, um den anglophonen Ort der Handlung zu evozieren (Ms., Pennington Publishing), sei es, weil der Begriff auch in der deutschen Alltagssprache häufig durch einen Anglizismus (CEO) ersetzt wird. In die dritte Kategorie fallen ganze Sätze oder sogar Abschnitte, die keinen Sinn ergeben bzw. bei denen ich bezweifele, dass sie richtig übersetzt wurden. Würde es sich nicht um eine Übersetzung handeln, würde ich an diesen Stellen die Autorin kontaktieren. Weil ich weiß, dass es sich um eine Übersetzung handelt, konsultiere ich das Original. Nur für diese Stellen. Dabei sehe ich aus den Augenwinkeln anderes, was DeepL falsch gemacht hat. Auf sinnentstellende Art Anführungszeichen verschoben, zum Beispiel. Aber das hat mich hier nicht zu interessieren, meine Aufgabe ist ja, den Ausgangstext nicht zu beachten. Ich konzentriere mich also auf zwei Stellen: Auf die, an der die CEO so spricht, als wollte sie die Leserschaft brainwashen, und die, an der ein unschöner Themensprung das Lesevergnügen massiv stört. Die erste Stelle erweist sich als korrekt – da muss lediglich ein wenig an der Formulierung gefeilt werden. Bei dem Themensprung handelt es sich aber tatsächlich um einen Übersetzungsfehler; aus »I can multitask my heart out« ist »kann ich mich austoben« geworden. Das würde irgendwie hinkommen und vielleicht auch nicht weiter auffallen, wenn nicht ausgerechnet dem Multitasken die Funktion als Bindeglied zwischen zwei Absätzen zugeteilt worden wäre. Der von DeepL zerhackte, ehemals glatte Übergang zwischen zwei Sinnabschnitten wäre beim Schmökern gegebenenfalls nicht aufgefallen, aufmerksam Lesende hätten die Stelle aber zumindest als sehr holprig empfunden. Ich repariere den Fehler und kann die letzte rote Markierung entfernen. So richtig geheuer ist mir das Resultat meines Lektorats aber nicht. Denn neben den vielen Unsicherheiten, die jedes Lektorat und jede Übersetzung mit sich bringt, kommt hier die Befürchtung hinzu, dass der »Ausgangstext« durch die maschinelle Übersetzung verursachte Fehler enthält, von denen ich nichts ahne. Und das ist ziemlich nervenaufreibend, wenn man so vielen Instanzen gleichzeitig gerecht werden will: dem Original, der Person, die das Original verfasst hat, denen, die den Zieltext veröffentlichen, denen, die den Zieltext rezipieren werden, der Originalsprache sowie der Zielsprache.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Humanübersetzung des Textes mutmaßlich wesentlich weniger aufwendig und zeitintensiv gewesen wäre als das Lektorat der maschinellen Übersetzung, und dass im Resultat sicherlich noch Fehler stecken, die in der Humanübersetzung nicht vorgekommen wären. Da ich mit Forscherblick an dieses Lektorat herangegangen bin, hat es mir Spaß gemacht, aber hätte ich mich durch Hunderte von Seiten voller Stilblüten und wörtlich übersetzter Redewendungen arbeiten müssen, wäre ich vermutlich nach wenigen Stunden wütend über den unnötigen Extraaufwand geworden. Liegt einem das Original nicht vor, kommt obendrein die Sorge hinzu, manche Übersetzungsfehler nicht zu bemerken. Läge es einem vor, würde man sicher schnell dazu übergehen, es neu zu übersetzen, um Zeit zu sparen und seine Nerven zu schonen …
Review
von Else Laudan
Was mir am meisten auffällt, ist die Diskrepanz zwischen reinem Entzücken über die Reflexion, die ich grandios und überdies wunderbar zu lesen finde, und meiner Kritik am Ergebnis, konkret am Leseerlebnis des lektorierten Texts.
Die Reflexion ist absolut toll (auch wenn es mich sehr verblüffte, dass die Kollegin »geschummelt«, nämlich den Originaltext hinzugezogen hat). Es ist eine großartige Bestandsaufnahme, die zu lesen mir unheimlich Freude bereitet hat, weil die ganze Arbeitsweise samt Emotionen und Frust so herrlich transparent gemacht und jedes Manöver so gut erklärt wird. Bei der Lektüre der Reflexion bekam ich spontan Lust, mit einer so wachsamen und umsichtigen Übersetzerin zusammenzuarbeiten. Vielleicht ist meine Kritik am lektorierten Text daher umso penibler geraten. Denn obwohl ich beim Lesen der Reflexion den Eindruck hatte, dass unsere Erfahrungen und Ansprüche sich enorm stark überschneiden, war ich mit dem Textresultat nicht zufrieden – was auch gegen die Eignung des MÜS spricht.
Mir ist der lektorierte Text noch zu wortreich, nicht geschmeidig genug, da fehlt die schmökertypische Leichtigkeit des Flusses, die sich mühelos liest, darauf kommt es gerade im »Unterhaltungsgenre« – vom trivialsten Liebesroman bis zum hochliterarischen Politkrimi – unbedingt an. Ich ahne aufgrund der gezeigten Details (Umhertigern auf Highheels, die glotzenden Vögel, das automatische Mitnicken …) ein Bemühen um lässige Ironie und einen flotten, leicht bissigen Ton, auch die Wahl des Präsens als Erzählzeit verrät den Wunsch nach Unmittelbarkeit und Tempo. Infolgedessen würde ich ein paar Tricks anwenden, um mehr Fluss und Geschwindigkeit reinzubringen – immerhin habe ich extrem viel Routine darin, einen Text beim Übersetzen auf Tempo zu bürsten.
Konkret schlage ich vor: auf Bremswörter wie »während« verzichten, Gleichzeitigkeit lieber durch »und« oder Komma ausdrücken, sparsamer mit bestimmten und unbestimmten Artikeln sein, hier und da etwas straffen, Relativsätze, wo es irgend geht, durch andere Konstruktionen ersetzen (z. B. im ersten Satz nicht die »Meter, die liegen«). Letzteres vor allem, weil die flinke und leichte -ing-Form des Englischen im Deutschen schnell zu langen Relativsatzschachteln führt, wenn man nicht ein Repertoire von Alternativen einsetzt, durch die sich solche Komma-die-Komma-der-Schachteln (oder gar die mir verhassten Komma-dass-Komma-dass-Schachteln) vermeiden lassen. – Ich hab spaßeshalber die ersten drei Absätze der Vorlage einmal selbst redigiert und komme, ohne inhaltlich Relevantes wegzulassen, auf 200 statt 247 Wörter und einen flotteren Text. Hier meine Version:
Ich stakse in unbequemen Highheels im hinteren Teil des überfüllten Konferenzraums auf und ab, bewege mich möglichst leise auf den drei Metern zwischen meinem widerwillig ausweichenden Kollegen Clyve und der Bande glotzäugiger Fischadler, die von der alten Tapete auf mich herabstarren. Wie bei jeder Versammlung im Magnolienraum nerven mich die aufgedruckten Vögel. Ms. Pennington macht bei ihrer Ansprache eine Pause, unwillkürlich nicke ich mit allen anderen und werfe einen Blick auf meine Smart Watch. Erst 3600 Schritte heute, dabei ist schon fast Mittag.
Ich komme auf einem dünnen Absatz gefährlich ins Schwanken, mache auf dem dicken roten Teppich schnell einen kleineren Schritt und streiche am Ende eines Absatzes drei Wörter weg. Das ist einer der Vorteile als angestellte Lektorin in einem Verlag, der noch altmodischer ist als die bei Teenagern jetzt wieder angesagten Overalls aus den Achtzigern: Hier laufen alle mit dicken Papierstapeln durch die Gegend, Stift hinterm Ohr und gestresste Miene, und kritzeln bis zur letzten Minute Anmerkungen in Manuskripte.
Tatsächlich fällt man bei Pennington Publishing aus dem Rahmen, wenn man bei den vielen Besprechungen des Tages nicht mindestens ein Manuskript bei sich hat. Darum zuckt niemand mit der Wimper, wenn ich mitten im Meeting durch die Seiten blättere.
Insgesamt ist mir der lektorierte Text etwas zu behäbig, zu umständlich, nicht sinnlich genug – mit »sinnlich« meine ich, dass die genannten Details sich unmittelbar in filmische Bilder im Kopf umsetzen, ohne dass etwas bremst oder hakelt oder grammatisch konstruiert wirkt. Er bräuchte für mein Gefühl einen weiteren Durchgang, vielleicht mit noch mehr Abstand, jedenfalls mit radikalerem Auf-Tempo-und-Fluss-Bürsten. Noch ein Beispiel:
Vorlage: Das ist eine nette Geste, aber ich weiß nicht, ob die ganze Welt in den Besitz meines neuesten Werks kommen muss: The Incredible World of Words: Ein Leitfaden für Epistemophile.
Lektoriert: Das ist schön gesagt, aber ich bezweifele, ob jeder in den Besitz des Titels kommen muss, an dem ich zuletzt gearbeitet habe: Die unglaubliche Welt der Wörter: Ein Kompendium für Epistemophile.
Hier finde ich das Lektorierte fast umständlicher als die Vorlage, dabei soll der Absatz ja vor allem eine Pointe sein. Ich hätte daher eher straff zugespitzt:
Gut gemeint, aber ich habe Zweifel, ob die Welt so dringend braucht, woran ich aktuell arbeite: Die unglaubliche Welt der Wörter: Ein Handbuch für Bildungshungrige.
Nicht ganz glücklich bin ich auch mit der Wortwahl bei den Sätzen zur Verlagsbranche, möglicherweise weil ich da als Verlegerin sehr dicht dran bin und deshalb pingelig. Beispiel:
Vorlage: Trotz der glorreichen Jahre … konnte er nicht mit dem soliden Tuckern der größeren, gut geölten Maschinen mithalten. Die Pennington ist ein Segelboot. Ein wunderschöner Regattakutter von Pen Duick, dessen Besitzer mit Stolz über die Palisander-, Mahagoni-, Teak- und anderen exotischen Tropenhölzer des Rumpfes streicht, während er das riesige weiße Segel über ihm beobachtet, das sich in der salzigen Brise wiegt. Aufwendige Details. Anders als alle anderen.
Aber das ist nur ein dümpelnder Fleck im Vergleich zu dem Ozeandampfer, der da durchfährt.
Lektoriert: Trotz der erfolgreichen Jahre … konnte der Verlag nicht mit den großen Pötten mithalten, mit dem stetigen Tuckern ihrer gut geölten Motoren. Neben ihnen ist Pennington Publishing ein Segelboot. Eine wunderschöne Rennyacht von Pen Duick, deren Besitzer voller Stolz mit der Hand über den aus Palisander-, Mahagoni-, Teak- und anderen exotischen Tropenhölzern gefertigten Rumpf streicht, während er zusieht, wie sich das große weiße Segel über ihm in der salzigen Brise bläht. Aufwendige Ausstattung. Einzigartig.
Aber eben nur ein winziges vor sich hin dümpelndes Fleckchen neben dem Ozeandampfer, der an ihr vorbeizieht.
Kritik: Die großen »Pötte« sind zwar ein nautisches Bild, aber das scheint mir mit seiner arbeitsweltromantisch-rostigen Konnotation nicht ideal zu transportieren, worum es geht: das grundlegend Maschinenhafte der Konzernverlage. Und Pen Duick ist der Name der Segelyachten und ihrer Regatten, sie sind nicht »von Pen Duick« (sondern von Éric Tabarly). Und da das Lektorat im Satz zuvor schon die »Marktriesen« aufgebracht hat (was mir gut gefällt!), ist es schade, am Ende zeitlich zurückgehen zum anachronistischen Bild des »Ozeandampfers«, statt den Riesen wiederaufzugreifen, der zudem moderner klingt:
Trotz glorreicher Jahre … konnte Pennington mit dem unablässigen Schub der größeren, gut geölten Maschinen nicht mithalten. Pennington ist ein Segelboot. Eine wunderschöne Pen Duick-Rennyacht, ihr Besitzer kann mit Stolz über die Palisander-, Mahagoni-, Teak- und sonstigen exotischen Tropenhölzer des Rumpfs streichen und zu dem großen weißen Segel aufschauen, das sich in der salzigen Brise bläht. Liebevolle Details. Einzigartig.
Aber gegen den vorbeiziehenden Ozeanriesen eben bloß ein dümpelnder Klecks.
Zu guter Letzt sprang mir ins Auge, dass es im lektorierten Text noch kleinere Flüchtigkeitsfehler gibt, z.B. heißt es erst »Ms. P.«, dann mehrmals »Frau P.«, dann »Mrs. P.«.
Als routinierte Lektorin hätte ich also einiges anders gemacht, und die Diskrepanz zwischen der hochkompetenten, umsichtigen Reflexion und dem Ergebnis lässt mich vermuten, dass die Kollegin einfach viel besser übersetzt als lektoriert. Und daher kommt sie völlig mit Recht zu ihrem Schluss: »Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Humanübersetzung des Textes mutmaßlich wesentlich weniger aufwendig und zeitintensiv gewesen wäre als das Lektorat der maschinellen Übersetzung.«
Ihr Reflexionstext findet bei mir viel Zustimmung an allen Punkten. Die Feststellung, dass man auf diese Art mit drei statt zwei Texten jonglieren muss, finde ich erhellend. Ich halte außerdem fest, dass der MÜS-Text beim Liebesroman viel weiter danebenliegt als bei dem Sachtext, den ich bearbeitet habe.
Ihre Einschätzung des Zeitaufwands (generell sehr, sehr viel mehr als eine Direktübersetzung) ist für sie klar zutreffend, weckt bei mir aber hinsichtlich der Übertragbarkeit leise Zweifel: Zum einen glaube ich, das liegt teilweise auch an dem Spezialfall mit der Unkenntnis des Originals. Wenn die Übersetzerin erst – vielleicht Kapitel für Kapitel – das Original durchlesen und dann lektorieren könnte, würde es meines Erachtens deutlich schneller gehen. Zum Zweiten entspricht es bei mir der gewohnten Lektoratspraxis, mit drei Texten zu jonglieren: Ausgangstext, zu lektorierende Übersetzung und werktreuer Zieltext, der den Finessen der Autorin so gerecht wird, wie ich es für richtig halte.
Von daher decken sich die Erfahrungen der Übersetzerin nicht mit meinen – weil die MÜ sich für die Anforderung eines locker wegschmökerbaren, süffigen Romans offenbar sehr viel schlechter eignet als für einen (wiewohl unterhaltsam gehaltenen) Sachtext, aber auch, weil ich beruflich einfach viel mehr Lektoratsroutine mit Texten anderer habe.
Nachgedanke: Verschiebt die Arbeit mit MÜS-Texten also vielleicht die kreative Tätigkeit der Übersetzerin hin zu der einer (kreativen) Lektorin? Und wenn ja, was folgt daraus? Ich muss an die Automation im Bereich Druck und Satz denken, die widersprüchlichen Entwicklungsprozesse – zugespitzt gesagt wurde beispielsweise in den 1970ern aus einer stolzen rein männlichen Handwerkertradition mit krassen Hierarchien ein ganzheitlicherer Beruf mit hoher Frauenquote. Sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo bedrohter Zunftstolz auf der einen Seite steht, auf der anderen ein unaufhaltsamer Veränderungsprozess? Meine Arbeitsrealität als geplagte Lektorin eines unprofitablen, idealistischen Kleinverlags könnte dabei gewinnen, aber die breitere Realität im System, wo profitorientierte Konzerne immer weniger Geld für kompetente Spracharbeit aufwenden und immer fettere Gewinne einsacken, stimmt düster.
Bild: Виталий Сова